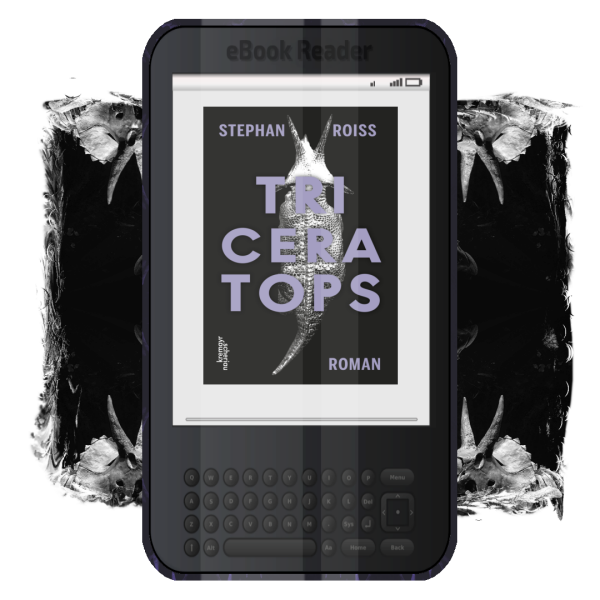
Ein Rezensionsexemplar des Buches wurde mir von Netgalley im Auftrag des Verlags zur Verfügung gestellt.
© Cover ‘Triceratops’: Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG
© Bild Smartphone: Pixabay
Handlung
Ein kleiner Junge malt Monster in seine Schulhefte und spricht von sich selbst als Wir. Seine Mutter schluckt in der geschlossenen Anstalt Neuroleptika mit ungesüßtem Früchtetee hinunter. Der bibeltreue Vater kocht nur Frankfurter und die Schwester bewegt sich wie ein Geist durch das Haus. Die einzigen Vertrauten des Jungen sind die Aschbach-Großmutter und später die blauhaarige Helix, die auf ihrem Snakeboard in sein Leben fährt.
Eines Tages ereignet sich eine Tragödie, die das Wir und die ganze Familie von Grund auf erschüttert. In harten Schnitten und bildhaften Szenen erzählt Stephan Roiss die Geschichte seines namenlosen Protagonisten, der dem Trauma und der Einsamkeit zu entfliehen versucht. Ein intensiver Roman, der lange nachhallt.
(Klappentext)
»Es kann gar nicht mehr schön werden, oder?«
Der erste Eindruck ist, das hier offensichtlich ein Rollentausch vorliegt:
Die Mutter heult und jammert, um Aufmerksamkeit zu bekommen, der Sohn muss immer für emotionale Unterstützung verfügbar sein. Die Tür zum Kinderzimmer hat grundsätzlich offen zu stehen, damit er sie weinen hören und direkt trösten kann, und als er Tür und Ohren mal leise schließt, reagiert die Mutter umgehend mit passiv-aggressiver Schuldzuweisung.
Das unglückliche Kind isst zuviel, wird übergewichtig, hat ständig Ekzeme und wird daher auch noch in der Schule gemobbt. Es hätte gerne die Hörner, den Nackenschild und den wehrhaften Panzer eines Triceratops, tatsächlich kratzt er sich die dünne verletzliche Haut, bis sie in blutigen Fetzen hängt.
Es gibt kein “Ich”.
“Nachdem sich der Fluss beruhigt hatte, standen wir auf und stellten uns auf die unterste der steinernen Stufen, die neben uns ins Wasser führten. Das gegenüberliegende Ufer konnten wir im Nebel bloß erahnen. Wir schlossen die Augen. Langsam kippten wir vornüber.”
Der Erzähler spricht in der Wir-Form von sich, was hier keineswegs wirkt wie Pluralis Majestatis – ganz im Gegenteil. Daraus spricht eine tiefe Verwundung, eine bodenlose Haltlosigkeit, auch wenn man als Leserin nur spekulieren kann:
Kann das Kind sich selber abweichende oder gar negative Meinungen bezüglich der Mutter nicht gestatten und muss diese daher in eine zweite Persönlichkeit abspalten? Ist es so einsam, dass es Trost sucht bei sich selbst, dass es ein “Wir gegen den Rest der Welt”-Gefühl manifestiert? Der Autor lässt es offen, ein Warnsignal ist es so oder so.
Der Versuch, als Leserin fair zu bleiben:
Meine ursprüngliche emotionale Reaktion auf die scheinbare Selbstsucht der Mutter – ein gärend bitteres Bauchgefühl –, musste ich im Laufe des Romans immer wieder überdenken und anpassen. Lernen, sie nicht als Täterin zu sehen, sondern als zutiefst verwundete, kranke Frau. Es wäre allzu einfach, ihr zu zürnen, weil sie dem Sohn eine Verantwortung auflädt, die er ohne seelische Wunden gar nicht stemmen kann.
Sie selbst sagt von sich, sie habe ihren Kindern so viel Liebe gegeben, wie sie nur konnte. Und auch wenn ein Sündenbock die Geschichte vielleicht etwas leichter hinnehmbar gemacht hätte, ist doch offensichtlich, dass sie mit ihrer Rolle als Mutter und dem Leben an sich wirklich heillos überfordert ist. Sie schluckt Neuroleptika, muss oft in die Klinik, weil gar nichts mehr geht.
»Mutter hat die Pfanne vom Herd genommen«, sagte sie unvermittelt. »Sie hat sie auf den Boden gestellt und ist barfuß in das heiße Fett gestiegen. Du hast im Gitterbett geplärrt.«
Die Schwester des Erzählers ist vermutlich irgendwo auf dem autistischen Spektrum, was natürlich niemand realisiert, weil die Mutter die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch sie kann den Erzähler nur bedingt unterstützen und wird später zu einer weiteren Quelle der Sorge und des Traumas.
Ein Taumeln in den Abgrund:
Das verstörte Kind wird zu einem verlorenen Jugendlichen, zu einem strauchelnden jungen Mann. Er, immer der Namen- und Haltlose, sucht sich letztendlich Freunde, die ebenfalls Außenseiter sind, doch auch hier gibt es einen Bruch:
Um dazuzugehören, gibt er paradoxer Weise lange vor, stumm zu sein, fühlt sich offenbar sicherer in dieser Rolle, und lebt dadurch doch nur eine Lüge. Sogar seiner Freundin gegenüber erhält er die Täuschung aufrecht, dem Menschen, von dem er doch bedingungslose Akzeptanz erwarten könnte.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises ist dieses Jahr voller kaputter Familien.
“Triceratops” ist da keine Ausnahme: das Buch ist ein Aufschrei, die Geschichte eines jungen Menschen, der an den psychischen Störungen seiner Familie zerbricht. Es ist ein unheilvoller Domino-Effekt: der Großvater hat sich erhängt, die Mutter ist schwerst depressiv, die Schwester scheitert später katastrophal an ihrer eigenen Mutterrolle, der Vater kann das alles nicht mehr ertragen und greift zum Alkohol.
Und alles lastet schwer auf dem Rücken des Protagonisten, der sich schuldig fühlen muss für jeden Versuch, sich einen Raum für die eigenen Emotionen zu erobern. In seinen Gedanken streitet er ab, die Mutter zu lieben, als könne er sich damit auch der Co-Abhängigkeit entledigen:
“Wir sagten Mutter, dass wir sie lieben. Es war nicht wahr. Wir wollten nichts sagen, sie nicht berühren, nicht alleine mit ihr sein.“
Glück ist keine Option, hier geht es nur noch ums Überleben.
»Alles ist gut« zieht sich wie ein Mantra durchs Buch, dabei ist hier rein gar nichts gut, für niemanden. Man ist versucht, Schuld zuzuweisen, um dem Ganzen wenigstens irgendeine Art von Sinn zu geben – und damit zu suggerieren, dass es eine Lösung des Problems geben kann.
Wo ein Schuldiger ist, gibt es auch Bestrafung, Verbannung oder Verhandlung. Die Tante glaubt an einen Fluch und weist dem Protagonisten die Rolle des Fluchbrechers zu, was diesen noch mehr unter Druck setzt.
»Und niemand! Niemand war jemals wirklich da! Niemand!«
Die letzte Stabilität zerbricht mit dem Tod der Großmutter, dem einzigen Fixpunkt im Leben des Erzählers. Den Großvater hat er nie kennengelernt, aber dessen schon lange nicht mehr genutzte Hütte im Wald wird zu seinem Rückzugsort. Auf einer Karte hat der Großvater ein rätselhaftes “X” markiert, und es wird zur fixen Idee, diesen Ort zu finden, in der Hoffnung auf… Ja, auf was? Eine Erklärung? Ein Heilmittel? Erlösung? Vergebung? Der Erzähler verausgabt sich auf der Suche, ohne Rücksicht auf seine Gesund- oder Sicherheit.
Der Autor erzählt das in kompakter Form, die doch nie an erzählerischer Wucht verliert.
Der Schreibstil ist oft nüchtern, bringt die Dinge verdichtet und wie nebenbei auf den Punkt. In meinen Augen eine gute Wahl, denn ein hochemotionaler Stil hätte die inhaltliche Dramatik womöglich bis ins Pathos überreizt und für den Lesenden unzumutbar gemacht.
Die Geschichte liest sich so schon beklemmend und düster – es gibt hier keine neutrale Instanz, keinen Blick von außen, nur die klaustrophobische Hölle dieser gepeinigten Familie. Man ist als Leserin mittendrin, auch wenn der Erzähler versucht, sich in seinem “Wir” von ihr zu distanzieren.
Die Charaktere werden sparsam beschrieben, mit gerade genug Details und Einblicken in ihr Seelenleben, um sie in ihrem jeweiligen Trauma prägnant darzustellen. Dies ist eine dysfunktionale Familie wie aus dem Lehrbuch. Da ist es gut, zwischendurch einen Schritt zurücktreten und durchatmen zu können, wenn ein Erzählstrang abbricht und sich einen neuen Fokus sucht.
Fazit
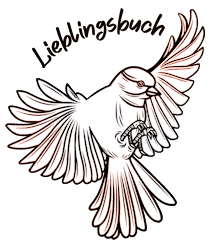
Der Protagonist ist der jüngste Sohn einer entsetzlich dysfunktionalen Familie. Der Großvater hat sich schon erhängt, die Tante glaubt, da sei der Wahnsinn auf ihre Schwester übergesprungen. Der Erzähler versucht, der depressiven Mutter Halt zu geben, während um ihn herum die familiären Strukturen immer weiter zersplittern: die vermutlich autistische Schwester ist ihm keine Hilfe, der Vater kann alles nicht mehr ertragen und trinkt.
Das könnte alles viel zu viel sein, der klare Schreibstil ohne Pathos hält jedoch alles zusammen. Der Autor führt den Leser mitten hinein in dieses familiäre Drama, ermöglicht ihm aber gleichzeitig genug Distanz, dass man die Geschichte aushält und auch weiterlesen will.
Rezensionen zu diesem Buch bei anderen Blogs
Buch-Haltung
literaturleuchtet
Wallis Büchersichten
Tii und Ana’s kleine Bücherwelt
Litla Gletta
Literaturgeflüster
Frieda Frei
Empfehlungen aus dem gleichen Genre
Jean-Paul Dubois: Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise
Lorenz Just: Am Rand der Dächer
Valerie Fritsch: Herzklappen von Johnson & Johnson
Peter Zantingh: Nach Mattias
Rebecca Makkai: Die Optimisten
| Titel | Triceratops |
| Originaltitel | — |
| Autor(in) | Stephan Roiss |
| Übersetzer(in) | — |
| Verlag* | Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG |
| ISBN / ASIN | 978-3-218-01229-4 (Hardcover) 978-3-218-01245-4 (eBook) |
| Seitenzahl* | 208 |
| Erschienen im* | August 2020 |
| Genre | Gegenwartsliteratur |
| * bezieht sich auf die abgebildete Ausgabe des Buches | |
Das Buch auf der Seite des Verlags
 (Leider musste ich die Kommentarfunktion auf WordPress
(Leider musste ich die Kommentarfunktion auf WordPresswegen massivem Spam und Botattacken ausstellen!)

